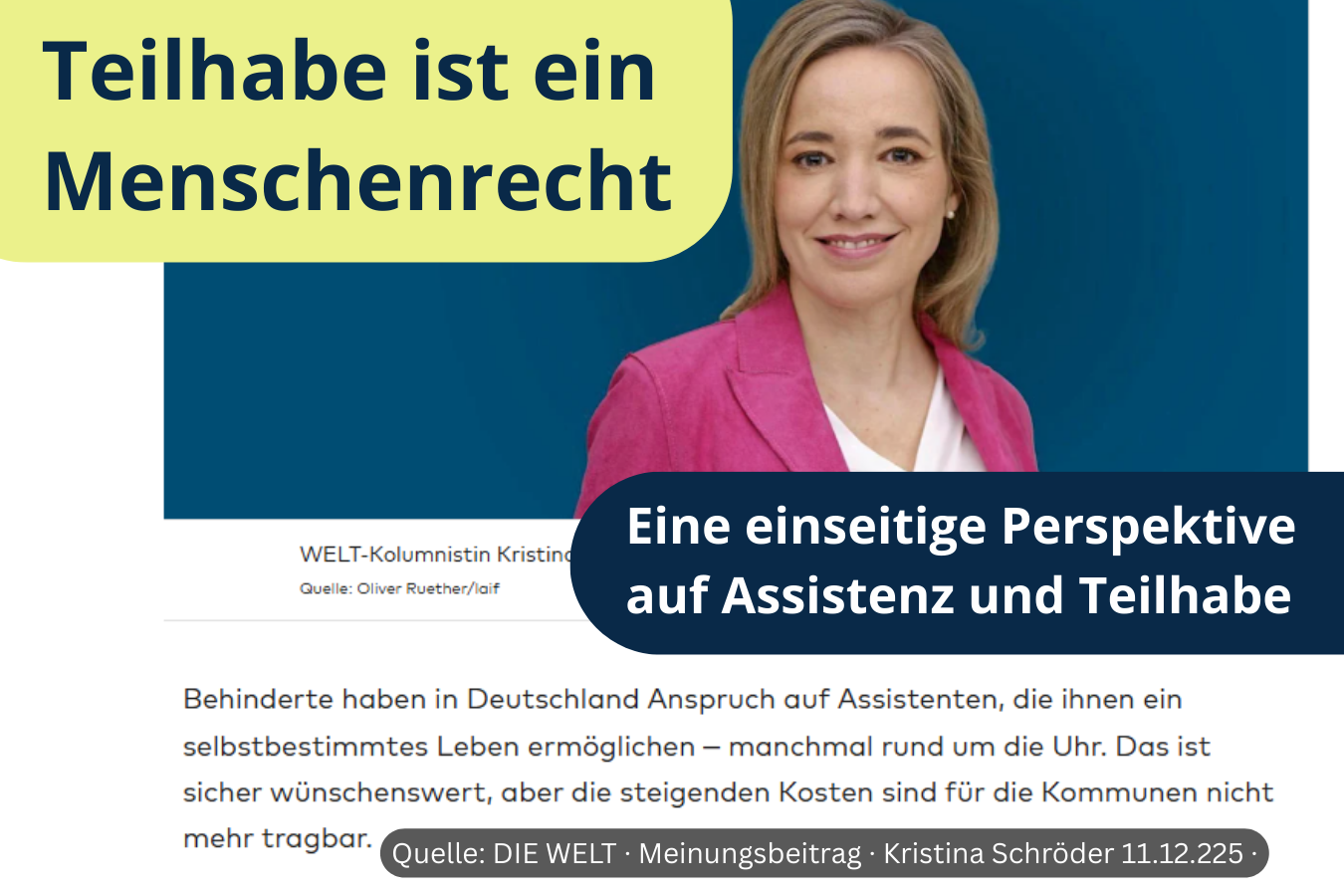
Teilhabe ist ein Menschenrecht
Kristina Schröder fragt in der WELT, „was wir uns künftig nicht mehr leisten können“ – und meint damit unter anderem die Eingliederungshilfe, das Persönliche Budget und Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderung. Der Text ist sorgfältig formuliert, empathisch im Ton, aber problematisch in der Sache. Denn er verschiebt die Perspektive: Weg von Rechten, hin zu Kosten. Weg von Systemfragen, hin zu Einzelfällen. Und genau darin liegt das Problem
1. Kosten sind kein Ausreißer – sie sind Folge von Grundrechten
Die im Beitrag beschriebenen Leistungen sind kein politisches Wohlwollen, sondern die Umsetzung eines verbindlichen Menschenrechts. Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK), die Deutschland 2009 ratifiziert hat, garantiert in Artikel 19 das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und volle Teilhabe in der Gemeinschaft.
Hohe Assistenzkosten entstehen dort, wo Barrieren hoch sind – nicht, weil Ansprüche „zu weit“ gingen. Die Alternative zur Assistenz sind institutionelle Unterbringung, Heimunterbringung oder Klinikaufenthalte. Diese sind häufig genauso teuer oder teurer – bei deutlich weniger Teilhabe.
Nicht Assistenz ist teuer, sondern Ausgrenzung.
2. Persönliches Budget ist oft günstiger als Heime und Großträger
Schröders Text erweckt den Eindruck, ambulante Assistenz sei per se kostentreibend. Das Gegenteil ist vielfach belegt: Persönliche Assistenz im Arbeitgebermodell ist oft effizienter als stationäre Einrichtungen oder große Assistenzdienste mit hohem Verwaltungs-Overhead.
Kommunen berichten regelmäßig von vergleichbaren oder sogar geringeren Kosten, höherer Zufriedenheit der Leistungsberechtigten und sinkenden Folgekosten – etwa durch weniger Krisen, Krankenhausaufenthalte oder Pflegebedürftigkeit.
Selbstbestimmung spart Bürokratie – nicht umgekehrt.
3. 200.000-Euro-Fälle sind kein Maßstab für ein ganzes System
Ja, es gibt Assistenzarrangements mit Jahreskosten von über 200.000 Euro. Aber sie betreffen eine sehr kleine Gruppe von Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf, etwa bei 24-Stunden-Assistenz. Diese Menschen hätten auch ohne Persönliches Budget hohe Kosten: in Heimen, Intensivpflege oder Kliniken – oft lebenslang.
Ein Bericht der Bundesregierung zum Persönlichen Budget stellt dazu klar, dass die Mehrheit der bewilligten Budgetsummen zwischen 200 Euro und 800 Euro pro Monat liegt (Drucksache 16/3983 S. 49). Hohe sechsstellige Jahreskosten sind also nicht repräsentativ für Persönliche Budgets insgesamt.
Quelle: Bericht der Bundesregierung über die Ausführung Der Leistung des persönlichen Budgets - Seite 49
Einzelfälle werden im WELT-Beitrag zur Systemkritik hochskaliert. Das ist statistisch unseriös. Entscheidend ist nicht die Zahl auf dem Papier, sondern die Frage: Was kostet dieselbe Person im Alternativsystem – und mit welchen Lebensperspektiven?
4. Die „weite Definition von Behinderung“ ist kein Fehler
Die Kritik an der breiten Definition von Behinderung verkennt ihren Ursprung. Sie folgt der WHO-Systematik (ICF) und der UN-BRK: Behinderung entsteht durch das Zusammenspiel von Beeinträchtigung und Barrieren.
Psychische, psychosoziale und neurodivergente Beeinträchtigungen sind real – und sie verschwinden nicht, wenn man Unterstützung verweigert. Im Gegenteil: Frühzeitige Prävention verhindert Erwerbslosigkeit, Pflegebedürftigkeit und soziale Isolation.
Prävention kostet – Nichtstun kostet mehr.
5. Assistenz ermöglicht Arbeit, Bildung und Teilhabe
Was im Beitrag fast vollständig fehlt: Viele Nutzer:innen des Persönlichen Budgets arbeiten, studieren, gründen Unternehmen oder engagieren sich ehrenamtlich. Ohne Assistenz gäbe es keinen Zugang zum Arbeitsmarkt, zu Bildung oder zu gesellschaftlicher Teilhabe.
Assistenz ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition. Menschen mit Behinderung zahlen Steuern, Sozialabgaben und Mehrwertsteuer – sie schaffen Arbeitsplätze und sichern damit Existenzen.
6. Die eigentliche Kostenfrage bleibt unbeantwortet
Die entscheidende Frage lautet nicht: Was kostet Assistenz?
Sondern: Was kostet Ausgrenzung?
Höhere Pflegekosten, mehr Krankheitsfolgen, geringere Erwerbsquoten und steigende Sozialtransfers sind die Rechnung eines Systems, das Heimstrukturen fördert, die gewinnorientiert arbeiten, statt Teilhabe zu ermöglichen. Diese Kosten tauchen in keiner Schlagzeile auf – belasten aber dauerhaft die öffentlichen Haushalte.
Fazit
Die Eingliederungshilfe ist kein moralisches Tabu, sondern ein rechtsstaatliches Versprechen. Wer sie infrage stellt, sollte ehrlich sagen, welches Grundrecht er relativieren will – und welche Alternativen er für die Betroffenen vorsieht.
Die eigentliche Frage ist nicht, ob wir uns Teilhabe leisten können.
Sondern, ob wir uns ihre Verweigerung leisten wollen.

